Nebenan plätschern die «Desperaten Hausweifen» vor sich hin und ich lausche wie jeden Montag den süssen Dialogen und warte gespannt, ob ich vielleicht heute Abend einen Hinweis darauf finden kann, warum diese Serie in den Staaten ein solcher Erfolg sein soll.
Doch nun zum eigentlichen Thema von heute: «The Life and Death of Peter Sellers». Wie so oft habe ich eigentlich keine Ahnung von der Thematik des Films, denn obwohl ich vor Jahren wohl einen oder zwei Filme der «Pink Panther» Reihe gesehen habe, fand ich diese nicht besonders lustig und bis vor kurzem konnte ich kaum Peter Sellers von Peter Weller unterscheiden. [Jetzt verpasste ich doch prompt die erste Liebesszene bei den Hausweifen.]
Zurück zum Thema: Obwohl ich mich im Grunde nicht besonders für Peter Sellers erwärmen kann, muss ich den Film auf der ganzen Linie empfehlen, denn eine Vermutung scheint sich bei «The Life and Death of Peter Sellers» zu bestätigen: Die Qualität eines Biopic kann daran gemessen werden, wie gut man den Film finden kann, auch wenn man die grundlegende Figur nicht im vornherein kennt. (Das muss eine meiner holprigsten Formulationen seit langem sein.) Wie bereits bei «The People vs. Larry Flynt», «Man on the Moon» oder «The Aviator» hatte ich von den historischen Hintergründen im Vorfeld keine Ahnung, war dann jedoch von der filmischen Umsetzung umso mehr angetan.
Dasselbe trifft auch auf «The Life and Death of Peter Sellers» zu. Der Film funktioniert auf allen Ebenen so perfekt, dass es einfach ein Genuss ist, sich auf die Geschichte einzulassen und die Entwicklung der Figuren mitzuverfolgen. Insbesondere der Kunstgriff, die Geschichte auf mehreren Ebenen spielen zu lassen… Oh, gerade hüpfte eine fast nackte desperate Hausweif über meinen TV Bildschirm; ich glaube, langsam begreife ich das Konzept der Serie. Wo war ich? Ach ja, die Geschichte von Peter Sellers wird auf sehr ungewöhnliche, aber äusserst originelle Weise erzählt: In einer Art Rahmenhandlung wird man zu Beginn von Sellers persönlich in die Geschichte eingeführt, indem quasi die Handlung als Film im Film vorgestellt wird. Im weiteren Verlauf des Streifens wird die Geschichte immer wieder fliessend vom Erzähler unterbrochen, so dass man immer mehr den Überblick verliert, auf welcher Ebene der Erzählung man sich denn gerade befindet. Das Schöne dabei ist, dass dies überhaupt keine Rolle spielt und den Rhythmus der Geschichte nicht unterbricht. Beim genannten Erzähler handelt es sich notabene um den verkleideten Peter Sellers, der wiederum von Geoffrey Rush verkörpert wird. Dies mag nun etwas konfus tönen, im Film verwirrt dies jedoch nie, sondern funktioniert als formaler Kniff, um das eigentliche Hauptmotiv des Filmes wiederzuspiegeln: Die vermeintliche Unbestimmtheit oder gar Abwesenheit von Peter Seller’s ureigener Persönlichkeit.
An dieser Stelle scheint mir ein grosses Lob an Geoffrey Rush angebracht, denn obwohl er praktisch in jeder Szene des Filmes (mindestens einmal) vorkommt, nimmt man ihm die Figur des Peter Sellers zu jeder Zeit ab. (Ein Ding der Unmöglichkeit bei den Superstars wie z.B. Cruise oder Clooney, Travolta oder Pitt, die, so gut sie auch spielen, meistens eher Figuren verkörpern, die eben wiederum den Schauspielern Cruise, Clooney, Travolta oder Pitt zum verwechseln ähnlich sehen und sich auch so benehmen. «Ocean’s Twelve» bewies uns zum Glück, dass dies ja auch nichts Schlechtes sein muss.)
Die Hausweifen verabschieden sich übrigens gerade, wiederum halbnackt, und machen im Äther Platz für die nächste «TV-Sensation» aus den USA: Komisch, obwohl die Gestrandeten in «Lost» schon seit Wochen auf einer abgelegenen Insel ohne Kontakt zum Rest der Welt festsitzen, scheinen die Leute dort immer noch mehr Anziehsachen als die Hausweifen zu haben.
Man sollte sich «The Life and Death of Peter Sellers» auf jeden Fall anschauen, egal, ob man die Hintergründe nun kennt oder nicht. Und nachdem man das Grab von Ray Charles mit Grammies und Oscars zugeschüttet hat, ist es nur gut und recht, wenn man auch Peter Sellers Tribut dieser Art zollt, zumal «The Life and Death of Peter Sellers» nüchtern betrachtet um Längen unterhaltsamer ist als «Ray».
Archives | First published: April 23, 2005

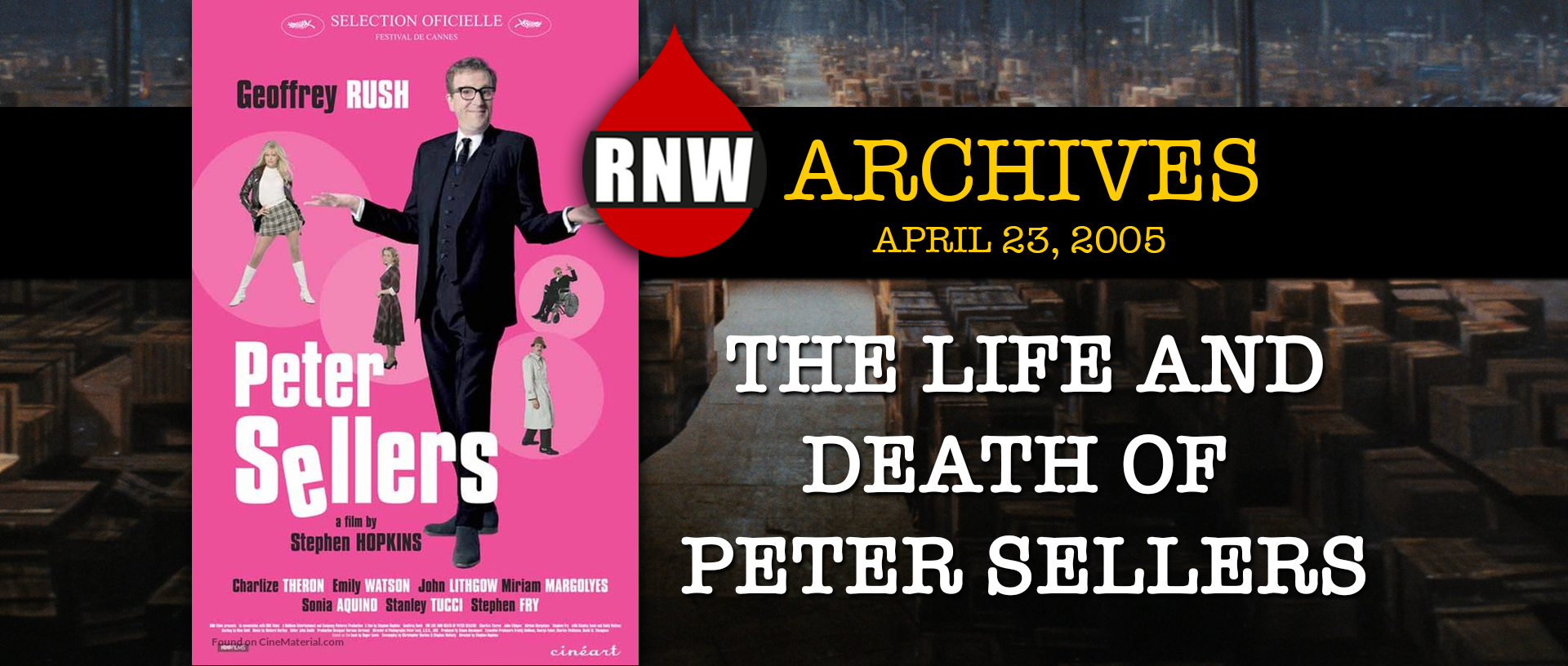
 Darf´s ein bisschen mehr sein?
Darf´s ein bisschen mehr sein? Auf diesen Film habe ich gewartet: Endlich ein wirklich guter Grund, wieder einmal eine neue Kritik zu verfassen.
Auf diesen Film habe ich gewartet: Endlich ein wirklich guter Grund, wieder einmal eine neue Kritik zu verfassen.  Es wird wieder kälter in unseren Breiten. Die Blätter fallen von den Bäumen, der Nebel setzt sich in den Tälern und die bedrückte Stimmung in den Herzen der Fussgänger fest. Der Herbst ist da. Doch während der eben noch so farbenfrohe Wald immer karger und das Wetter immer grauer wird, spielbergelt es auch wieder in den Kinosälen. Der verträumte Meisterregisseur bringt uns in dieser kalten Zeit etwas fürs Gemüt: ‚The Terminal’.
Es wird wieder kälter in unseren Breiten. Die Blätter fallen von den Bäumen, der Nebel setzt sich in den Tälern und die bedrückte Stimmung in den Herzen der Fussgänger fest. Der Herbst ist da. Doch während der eben noch so farbenfrohe Wald immer karger und das Wetter immer grauer wird, spielbergelt es auch wieder in den Kinosälen. Der verträumte Meisterregisseur bringt uns in dieser kalten Zeit etwas fürs Gemüt: ‚The Terminal’. Ich hätte einige Gründe, bei dieser Kritik mal wieder so richtig dreinzufahren: Warum etwa sollte man sich einen Film anschauen, der stellenweise daherkommt wie ein Telekolleg für suizidär veranlagte Menschen?
Ich hätte einige Gründe, bei dieser Kritik mal wieder so richtig dreinzufahren: Warum etwa sollte man sich einen Film anschauen, der stellenweise daherkommt wie ein Telekolleg für suizidär veranlagte Menschen? ´Snowball in Hell´ – Für diesen Streifen bekam Steven Seagal im Film ´In & Out´ einen Oskar als bester Schauspieler. Wer Steven Seagal kennt und ´In & Out´ gesehen hat oder zumindest der englischen Sprache mächtig ist, wird nun hoffentlich schmunzeln, denn ´Snowball in Hell´ war wohl der beste Gag in Frank Oz´ Komödie von 1997.
´Snowball in Hell´ – Für diesen Streifen bekam Steven Seagal im Film ´In & Out´ einen Oskar als bester Schauspieler. Wer Steven Seagal kennt und ´In & Out´ gesehen hat oder zumindest der englischen Sprache mächtig ist, wird nun hoffentlich schmunzeln, denn ´Snowball in Hell´ war wohl der beste Gag in Frank Oz´ Komödie von 1997. Es gibt ja Hollywood-Schauspieler, die erklären jedem, den es interessiert (und auch allen anderen), wie sie sich bei der Rollenwahl bemühen, möglichst nicht in diese kleinen Besetzungsschachteln gesteckt zu werden. Wir Zuschauer sind natürlich jedes Mal erleichtert, wenn wir dieses Statement aus dem sprachfähigen Kopfloch eines Hollywood-Schauspielers hören. Solche Einblicke in die Abgründe einer Schauspielerseele sind ja meist unglaublich informativ, etwa wenn uns [beliebigen Schaupielernamen einfügen] erklärt, wie familiär doch die Atmosphäre beim Dreh von [passenden Filmtitel einfügen] war. Oder wenn uns Bruno Ganz im TV-Interview zum zehntausendsten Mal erklärt, wie er die Rolle des Hitlers nicht mehr ausschlagen konnte, nachdem seine Ähnlichkeit zum deutsch-österreichischen Austauschdiktator schon so offensichtlich zum Vorschein kam, als er nur Perücke und Waffenrock anprobiert hatte.
Es gibt ja Hollywood-Schauspieler, die erklären jedem, den es interessiert (und auch allen anderen), wie sie sich bei der Rollenwahl bemühen, möglichst nicht in diese kleinen Besetzungsschachteln gesteckt zu werden. Wir Zuschauer sind natürlich jedes Mal erleichtert, wenn wir dieses Statement aus dem sprachfähigen Kopfloch eines Hollywood-Schauspielers hören. Solche Einblicke in die Abgründe einer Schauspielerseele sind ja meist unglaublich informativ, etwa wenn uns [beliebigen Schaupielernamen einfügen] erklärt, wie familiär doch die Atmosphäre beim Dreh von [passenden Filmtitel einfügen] war. Oder wenn uns Bruno Ganz im TV-Interview zum zehntausendsten Mal erklärt, wie er die Rolle des Hitlers nicht mehr ausschlagen konnte, nachdem seine Ähnlichkeit zum deutsch-österreichischen Austauschdiktator schon so offensichtlich zum Vorschein kam, als er nur Perücke und Waffenrock anprobiert hatte. Ich bringe es mal hinter mich – dann ist es raus: ´The Village´ ist enttäuschen. ABER wie könnte es auch anders sein?
Ich bringe es mal hinter mich – dann ist es raus: ´The Village´ ist enttäuschen. ABER wie könnte es auch anders sein? Es scheint, als hätte man besser noch ein halbes Jahr mit der Herausgabe des neuen Dudens gewartet. Die semantischen Perlen, mit denen uns da ´Chronicles of Riddick´ beglückt, gehörten nun wirklich in jedes lexikalische Standardwerk: Es ist schon erstaunlich, in welchem Ernst die Hauptcharaktere, allen voran natürlich Testosteronglatze Vin Diesel, Wörter wie ´Nekromonger´, ´Crematoria´ oder ´General Marshal´ über die Lippen bringen, ohne dabei auch nur mit der Wimper zu zucken. Diese ungewollte (?) Komik verleiht dem Film die nötige Leichtigkeit und einen gewissen Trash-Faktor, was den Film erträglich, ja irgendwie sogar charmant macht.
Es scheint, als hätte man besser noch ein halbes Jahr mit der Herausgabe des neuen Dudens gewartet. Die semantischen Perlen, mit denen uns da ´Chronicles of Riddick´ beglückt, gehörten nun wirklich in jedes lexikalische Standardwerk: Es ist schon erstaunlich, in welchem Ernst die Hauptcharaktere, allen voran natürlich Testosteronglatze Vin Diesel, Wörter wie ´Nekromonger´, ´Crematoria´ oder ´General Marshal´ über die Lippen bringen, ohne dabei auch nur mit der Wimper zu zucken. Diese ungewollte (?) Komik verleiht dem Film die nötige Leichtigkeit und einen gewissen Trash-Faktor, was den Film erträglich, ja irgendwie sogar charmant macht. Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Tatsächlich schaffte es dieser kompromisslose Splatterfilm in die Schweizer Kinos. Das hätte ich nun wirklich nicht für möglich gehalten. Darum war ich angenehm überrascht, als ich (spätestens nach dem Vorspann) begriff, dass dies nicht ein weiterer weichgespühlter Teenie-Horrorfilm war, sondern knallharte Splatter-Action der traditionellen Art. Die unvergleichliche, ausserordentlich gelungenen Mischung aus Metzgete und Humor überzeugt auf der ganzen Linie (wenn´s einem denn gefällt). Zwar besteht der Film praktisch nur aus aneinandergereihten Ekelszenen, verdichtet durch Spannungselemente und aufgelockert durch Humor und Fahrstuhlmusik, dies ist aber so konsequent und kompromisslos umgesetzt, dass es tatsächlich funktioniert und man zwar angewiedert, aber mit einem bitteren Grinsen und vor allem prächtig unterhalten, den Kinosaal verlässt.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Tatsächlich schaffte es dieser kompromisslose Splatterfilm in die Schweizer Kinos. Das hätte ich nun wirklich nicht für möglich gehalten. Darum war ich angenehm überrascht, als ich (spätestens nach dem Vorspann) begriff, dass dies nicht ein weiterer weichgespühlter Teenie-Horrorfilm war, sondern knallharte Splatter-Action der traditionellen Art. Die unvergleichliche, ausserordentlich gelungenen Mischung aus Metzgete und Humor überzeugt auf der ganzen Linie (wenn´s einem denn gefällt). Zwar besteht der Film praktisch nur aus aneinandergereihten Ekelszenen, verdichtet durch Spannungselemente und aufgelockert durch Humor und Fahrstuhlmusik, dies ist aber so konsequent und kompromisslos umgesetzt, dass es tatsächlich funktioniert und man zwar angewiedert, aber mit einem bitteren Grinsen und vor allem prächtig unterhalten, den Kinosaal verlässt.